 |
Lyrisches Singen: Zu Schuberts SpätstilWien, 1828: das Sterbejahr von Franz Schubert. Sechs Wochen vor
seinem Tod am 19. November bietet er einem Leipziger Verleger Schuberts Verhältnis zu Beethoven, bis heute nicht wirklich befriedigend erhellt, basierte auf Bewunderung seitens Schubert – „... wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“ – während Beethoven seinerseits dem um 30 Jahre Jüngeren Anerkennung zollte. Dennoch traf Schubert der Vorwurf, als Instrumentalkomponist übers klassizistische Epigonentum nicht hinausgekommen zu sein. Seine Klaviersonaten wurden von der Nachwelt am Sonatentypus Beethovens gemessen und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein verkannte man, daß sie in ihrer völlig andersartigen Konzeption diese vorgegebene Norm gar nicht mehr erfüllen wollten, sondern andere Gestaltungsmittel und Formverläufe ausloteten. An die Stelle zielgerichteter musikalischer Entwicklungsverläufe, einem Dualismus der Hauptthemen und strikter Durchführungen setzte Schubert einen assoziativen Gedankenfluß, irisierende klanglich—harmonische Farbwechsel und Melodien, deren vollendete Schönheit sich nicht zu einer wirklichen thematischen Verarbeitung eignete. Somit lassen sich Schuberts drei späte Sonaten „durchaus auch als Situationsbeschreibung des Komponierens nach Beethovens Tod interpretieren“ (Peter Gülke). Die klassische Sonatenform ist für Schubert nur noch eine Hülle, auf die er mit einer neuen ambivalenten Sprache reagiert: sie kennt weder Konsequenz noch Geschlossenheit, sondern gibt sich wie in einem Selbstgespräch einem lyrischen Gedanken und dessen Metamorphose hin. Abrupte Stimmungswechsel, Ein— und Ausbrüche, Dur—Moll—Kontraste, Verstummen und Aufbegehren begleiten den melodischen Fluß, der sich scheinbar wie von selbst zu tragen scheint, in seiner Idyllik indes immer wieder bedroht ist. Schubert komponiert eine Musik, die neue Dimensionen der musikalischen Zeit schafft, die Raum und Perspektive öffnet. In diesem Kosmos begegnet uns Schubert als „Wanderer“ zwischen zwei Welten: Neben dem heiteren liedhaften, bisweilen bodenständig—volkstümlichen Tonfall, der eben auch ein Wesensmerkmal seiner Instrumentalmusik ist, finden sich in jedem Werk auch tragische Zuspitzungen und dramatische Einbrüche – die Nachtseite in Schuberts lichtdurchfluteten Schaffen. Melancholische Töne trüben da die vermeintliche Heiterkeit, und Schubert selbst bekannte in diesem Sinne: „Meine Erzeugnisse sind durch den Verstand für Musik und durch meinen Schmerz vorhanden.“ Wenn Schubert, am 31. Januar 1797 in Liechtenthal bei Wien geboren und unter äußerst beengten Verhältnissen aufgewachsen, als erster „den Aufschrei, die Gemütserregung des menschlichen Herzens“ – so der Schubert—Biograph M.J.E. Brown – unmittelbar in Musik gesetzt hat, so war damit lange Zeit sicher der Liedkomponist gemeint. Mit der zunehmenden editorischen Erschließung und damit Wahrnehmung seiner Klavier—, Kammer— und Orchestermusik aber entdeckte man die ungeheuere emotionale Kraft des Instrumentalkomponisten Schubert. Diese findet sich besonders in der Trias der drei posthumen Klaviersonaten wie in Schuberts spätem Schaffen insgesamt. Indes von einem „Spätwerk“ oder gar „Spätstil“ bei Schubert zu sprechen, befremdet zunächst angesichts eines nur 31 Jahre währenden Lebens, von dem gerade mal fünfzehn Jahre (1813—28) dem kompositorischen Schaffen gewidmet waren. Und dennoch stellen die Werke des letzten Lebensjahres eine Art „Summa“ der Schubertschen Kunst dar, auch wenn schon in früheren Werken vieles kongenial angebahnt wurde. Bereits die Werke der Frühphase sind unverkennbarer Schubert, doch bringen die Spätwerke – wenn man diese Bezeichnung für die seit ca. 1827 bis 1828 entstandenen Kompositionen denn anwenden will – eine Extremisierung der charakteristischen Merkmale, eine noch zwingendere Unbedingtheit im Ausdruck. Klaviersonate B-Dur D 960Lediglich drei Sonaten erschienen zu Lebzeiten Schuberts im Druck (D 845, D 850 und D 894), andere wurden wenige Jahre nach seinem Tod von Freunden aus dem Nachlaß herausgegeben und erhielten posthume Opuszahlen. Hierzu gehört die monumentale B—Dur—Sonate D 960: Sie ist die letzte der drei posthumen Sonaten und damit die letzte Instrumentalkomposition Schuberts überhaupt. Lyrisches Singen bestimmt ihren Grundton, nicht das Austragen dramatischer Kontraste oder gar motivisch—thematische Arbeit. An die Stelle zielgerichteter Abläufe wie bei Beethoven setzt Schubert ein freies fabulierendes Fließen, ein Umkreisen und Weiterspinnen eines Hauptgedankens, eine entspanntere, mitunter kontemplative Tonsprache. Lang ausgesungene, fließende Melodiebögen im Kopfsatz, dagegen ein abgründiges Andante, ein heiteres Scherzo und schließlich ein bewegtes Schlußrondo stecken den weiten Rahmen ganz unterschiedlicher Empfindungsbereiche dieser formal wie inhaltlich ungemein reichen Sonate ab. Der erste Satz, „Molto moderato“, ist ganz nach innen gewendet und von einer außerordentlichen, in sich kreisenden Poesie. Die extrem lang gedehnte Exposition bringt harmonische Umbrüche und einen zerklüfteten, immer wieder stockenden Melodiefluß, der „in seinem Zeitverlauf das Bild von Ermüdung und Resignation“ (Dieter Schnebel) nachzuzeichnen scheint. Die Bewegung wird gestaut durch einen markanten grollenden Baß—Triller und durch Generalpausen, so daß schon das Hauptthema selbst stets aufs Neue bedroht ist von der „Gefahr des Verstummens“ (Peter Gülke). Fast hat es den Anschein, als setze Schubert hier seine Musik aufs Spiel, indem er sie mit Brüchen konfrontiert, die Grundtonart verschleiert, Hell und Dunkel, Dur und Moll aufeinanderprallen läßt und musikalische Profile schafft, um sie sogleich wieder aufzulösen. Um nochmals mit Peter Gülke zu sprechen: „Schuberts Musik bezahlt die lyrischen Paradiese teuer... dem Maß der Erfüllungen entspricht dasjenige ihrer Bedrohungen.“ All dies wird offensichtlich in der wechselvollen Gestaltung der zarten und zugleich erhabenen Melodie des Hauptthemas. Sie beginnt sehr vage mit melodisierten B—Dur—Klängen, deren Teiltöne sich über zwei Oktaven türmen. Der düstere Baß—Triller auf dem Kontra—Ges und eine Fermate setzen den schweifenden Klängen eine Zäsur. Es folgt ein zweiter Ansatz zu thematischer Entfaltung, der erneut im Halt durch Baß—Triller und Fermate endet, dann ein drittes Herantasten in weiträumigen Akkordbrechungen, im Sopran liegt die eigentliche Melodie, nun nicht mehr in Akkorden. Die pendelnde Achtel—Begleitung ist inzwischen einer Sechzehntel-bewegung gewichen, in größerem Bogen wird Ges—Dur anvisiert. In weiteren Anläufen wandert die Melodie vom Sopran in die Tenor— bzw. Baßstimme, bekommt zusätzliche Präsenz durch ein gefordertes Forte, moduliert in abgelegene Bereiche. In ihrem Fluß wird die Melodie so zu „einer quasi unendlichen Klangmelodie, die immer neue Räume erschließt“ (Dieter Schnebel). Ins Stocken jedoch gerät der Zeitfluß durch die retardierenden Momente der Fermate und des für Irritation sorgenden Trillers: dieser bewirkt eine Verwischung der Zeit, wird zum dunklen Fleck, der zum Aussetzen des Pulses führt. Der zweite Satz, „Andante sostenuto“ in cis—moll, steht dem ersten an innerer Gewichtung nicht nach: zum Ausdruck kommt hier einerseits ein schwermütiger Pessimismus, der auf der anderen Seite gebettet ist in zarte lichte Melodik, mit der ein versöhnlicher, friedvoller Ton Einzug hält. Unverhoffte harmonische Lichtwechsel durchziehen den Satz, der in seinen beiden Außenteilen mit einem extremen Überschlag der linken Hand arbeitet. Der unbeirrbar gleichmäßigen, fast starren Begleitung des Beginns folgt eine feierlich—erregte Sechzehntelbewegung im Mittelteil in der Paralelltonart A—Dur. Die Reprise des Satzes schließlich hält noch harmonische Chromatisierungen von großem Zauber bereit, und so verwundert es nicht, daß gerade dieser langsame Satz von der Nachwelt vielfach als Schuberts musikalisches Vermächtnis betrachtet wurde. Für Alfred Einstein bedeutete er „Abschied und Verklärung“, „Höhepunkt und Apotheose von Schuberts instrumentaler Lyrik“. Es folgen ein Scherzo in B—Dur und ein Trio in b—Moll von anmutiger Leichtigkeit. Doch selbst diese entpuppt sich bei näherem Hinsehen als schöner Schein, denn der extrem leise einsetzende Satzbeginn scheint aus einer geradezu irrealen Welt herüberzutönen. Im Trio dann sorgen nervöse Akzente und synkopierte Rhythmen für Irritation. Auch im Finale bleibt die Leichtigkeit ambivalent, der Rondosatz konfrontiert den Hörer mit dramatischen Brüchen und die erwartete Rondo—Heiterkeit mag sich nicht recht einstellen. Vielmehr knüpft der Allegretto—Satz an die Gestaltungsmittel des Sonatenbeginns an: wie schon im ersten Satz, geht es wiederum um die Gestaltung von Zeit, um das Vergehen von Zeit. Hier indes hält die Zeit nicht inne, sondern wird aufgehalten. Kein Baß—Triller bewirkt dies, sondern ein forte—piano anzuschlagender Ton, der der aus ihm hervorsprudelnden Musik immer wieder Einhalt gebietet. Es ist, als würde Einspruch eingelegt gegen den Fluß der Musik wie gegen den Fluß der Zeit überhaupt – gegen ihr Vergehen. Eine Allegorie auf das eigene nahe Ende, eine Analogie des Endes ganz allgemein? In seinem grundlegenden Schubert—Essay „Auf der Suche nach der befreiten Zeit“ (1968/69) fand Dieter Schnebel folgende Deutung dieses Schluß—Rondos: „Das verborgene Diminuendo des ganzen Stücks, das in den herausstechenden Sforzati der einzelnen Töne seine punktuellen Marken hat, registriert versiegende Kraft – ahnende Darstellung des bevorstehenden Todes.“ 3 Klavierstücke D 946Einen wesentlichen Beitrag zur Klaviermusik der Romantik leistete Schubert neben seinen Sonaten mit den Zyklen von Klavierstücken: den zwei Sammlungen der „Impromptus“ (1827), den „Moments musicaux“ (1828) und den „3 Klavierstücken“. Daß diese fast zeitgleich mit der letzten Sonaten—Trias entstandenen drei Klavierstücke große Nähe zu dieser besitzen, beweisen unzählige gemeinsame Merkmale. Konnte Schubert als Sonatenkomponist neben dem „Titan“
Beethoven noch Jahrzehnte nach seinem Tod nicht bestehen, so gelang
ihm dies zumindest als Meister der kleinen Form – des Liedes
und des kurzen einsätzigen Klavierstücks, in denen er
zu einer ungemeinen Komprimierung des Ausdrucks fand : Die Die Niederschrift von Nr. 1 und 2 datiert zu Beginn von Nr. 1 mit Mai 1828, die Niederschrift von Nr. 3 ist undatiert und erfolgte auf anderem Papier, doch legen Ähnlichkeiten im Schriftduktus und der musikalischen Faktur eine gemeinsame Enstehungszeit und Zusammengehörigkeit nahe. Anders als die „Moments musicaux“ D 780 erschienen die drei Klavierstücke nicht schon zu Schuberts Lebzeiten im Druck, sondern wurden erst 1868, vierzig Jahre nach seinem Tod, in drei separaten Heften anonym herausgegeben von Johannes Brahms. Für diesen spielte der zyklische Aspekt offenbar keine Rolle. Das erste Stück in es—Moll ist ein energievoll dahinjagendes „Allegro assai“, in dem Tonart, Tempo und Dynamik mehrfach auf kleinstem Raum wechseln (wie im zweiten Klavierstück auch). Episodische Einschübe sorgen für starke Kontraste, neuartige Tremolando—Effekte für eine düster—unheimliche Stimmung. Das Stück, begonnen in es—Moll, endet in Es—Dur. Das zweite Klavierstück setzt nahtlos auf demselben Grundton ein, so daß beide Stücke ineinander überzugehen scheinen. Formal ist das bemerkenswert lyrische zweite Klavierstück ein lose gefügtes, tonal weitgespanntes Rondo mit sanglichen Außenteilen, denen ein im Pianissimo beginnender, beklemmend wirkender c—Moll—Teil und ein fiebrig—unruhiger as—Moll—Teil gegenübergestellt sind. Episoden von berückender Zartheit und erschreckender panischer Unrast treffen hier aufeinander – Schuberts Welt ist zerrissen von schroffen, unüberbrückbaren Gegensätzen. Von heftigen Synkopen geprägt sind die Ecksätze des letzten Stücks, ein Allegro in C—Dur, das mit wirbelndem Schwung vordergründig an einen slawischen Tanz erinnert. Im modulationsreichen Trio—Mittelteil überrascht Schubert indes mit faszinierenden Farbwechseln, die er der geradezu hypnotischen Monotonie eines immer gleichen Rhythmus entgegensetzt. Warum ein Hammerflügel?
|
|
|
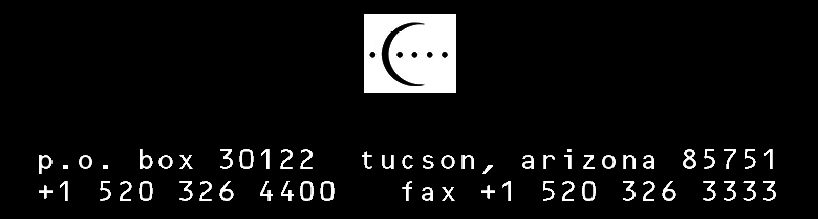 |